Klagen über Stress, Burnout und hohe Selbstmordraten unter Tierärtzten gibt es weltweit. „Schuld“ sind allzu oft auch überhöhte Erwartungen der Veterinäre an die eigene Leistungsfähigkeit. In den USA bindet man deshalb schon Psychologen ins Tiermedizinstudium ein. Warum und was sie dort raten, fasst dieser Artikel zusammen.
von Annegret Wagner
Die US-Amerikanische Tierärztevereinigung (AVMA) und der Verband der Veterinäruniversitäten (AAVMC) versuchen, Studenten besser auf das Arbeitsleben vorzubereiten. Vorreiter ist die Colorado State University, die bereits zum vierten Mal einen Kongreß zu den emotionalen Belastungen des Tierarztberufes veranstaltet hat (Veterinary Health and Wellness Summit). In Colorado beschäftigt die Veterinärfakultät sogar eine Psychologin.
Ausbildung vermittelt (nur) Wissen

PhD Laurie Fonken (Foto: © Privat)
PhD Laurie Fonken erklärt, warum eine frühe Einbindung von Psychologen in das Studium wichtig ist: „Studenten wählen Tiermedizin, weil sie wissenschaftliche und akademische Fähigkeiten haben. Aber auch, weil sie Menschen sind, die Mitgefühl besitzen und denen Menschen und ihre Tiere sehr wichtig sind.“ Bisher habe sich die Ausbildung an den Universitäten nur auf das Vermitteln von wissenschaftlichen Inhalten beschränkt. „Die emotionalen Anforderungen an die späteren Praktiker finden keine Berücksichtigung.“
Emotionaler Stress beginnt im Studium
Doch der emotionale Stress der Tierärzte beginnt häufig schon im Studium. Dr. Fonken erklärt, dass die Studenten in der Regel sehr gute Schüler mit entsprechend guten Noten sind (in Deutschland gilt ein Numerus Clausus von 1,x als Zugangsvoraussetzung). Im Studium seien sie jetzt umringt von anderen sehr guten Schülern und fühlten sich plötzlich nur noch durchschnittlich gut. Manche glaubten sogar, nicht ausreichend qualifiziert zu sein.
Diese Angst, intellektuell nicht zu genügen, ziehe sich oft bis ins Arbeitsleben. Viele junge Tierärzte lebten in ständiger – unbegründeter – Angst, jemand würde herausfinden, dass sie eigentlich absolute Nieten sind und sie als Hochstapler entlarven.
Diese latente Angst führt zu emotionalem Stress und potentiellen Depressionen. Und sie ist womöglich auch Grund dafür, dass viele junge Tierärzte nicht mehr die Verantwortung für eine eigene Praxis tragen wollen, in der sie alleine entscheiden.
Angst ist zunächst positiv
Für Dr. Fonken ist ein gewisses Maß an Unsicherheit oder Angst vor Versagen durchaus positiv: „Es motiviert, sich auch nach dem Studium fortzubilden und besser zu werden.“ Doch werde die Angst zu groß, stellten die Betroffenen sich nicht mehr den Herausforderungen, sondern versuchten, ihnen aus dem Weg zu gehen. Das Verdrängen führe häufig zu Alkohol- oder Drogenproblemen oder zu anderen Verhaltensmechanismen, die das Wohlbefinden beeinträchtigen.
Moralischer Stress insbesondere für Nutztierärzte
Es sei übrigens falsch anzunehmen, dass vor allem Kleintierpraktiker, die mit Kindersatz-Tieren umgehen müssen, emotional gestresst sind. Großtierpraktiker seien häufig viel stärker betroffen. Sie seien für eine viel größere Zahl von Tieren verantwortlich und müssten dabei ständig die Wirtschaftlichkeit ihrer Maßnahmen gegenüber dem Tierbesitzer beweisen.
Diese Art von Stress bezeichnet Dr. Fonken als „moralischen Stress“: In der Regel wüssten die Tierärzte genau, was zu tun sei. Aber aus ökonomischen Gründen und nach dem Willen des Besitzers dürften sie nicht dementsprechend handeln. Das wiederum führe zu Schuldgefühlen gegenüber den Tieren, die nicht die Behandlung/Betreuung bekämen, die ihnen zustehen würde beziehungsweise nötig wäre.

„Moralischer Stress“ wird vor allem Tierärzten in sehr großen Tierhaltungen nachgesagt. Hier zu sehen ein Betrieb aus den USA. (Foto: Lou Gold / common licence)
Tiere als Produktionseinheiten?
Selbst in den USA beginnt sich die Einstellung gegenüber landwirtschaftlichen Nutztieren aber zu ändern und sie werden – zumindest von einer steigenden Zahl von Verbrauchern und Tierärzten nicht mehr nur als „Produktionseinheiten“ gesehen.

Die großen US-Rinderbstände werden fast nur noch von Fremdarbeitskräften betreut. (Foto: © CAFO)
Doch es gibt auch andere Stimmen. So macht der US-Kollege Dr. Paul Biagiotti bei den Besitzern großer Milchviehbetriebe einen umgekehrten Trend aus. Sie entfernten sich immer weiter von ihren Tieren, da sie sich vor allem um die finanzielle Belange ihrer Betriebe kümmern (Einkauf von Futtermitteln etc., Vermarktung von Milch, Kälbern und Kühen). Das Wohlergehen der Tiere werde in die Hände von – oft möglichst günstig zu bezahlenden – Angestellten gelegt. Die hätten im Zweifelsfalle ein deutlich geringeres Interesse an der Tiergesundheit, als der Besitzer.
Einsamkeit auf dem Lande
Als ein weiteres Problem von Großtierpraktikern auf dem Land gilt der mangelnde Austausch mit Gleichgesinnten. Häufig beschränken sich die sozialen Kontakte auf die Kunden, da Zeit oder Gelegenheiten fehlen, Personen außerhalb des Jobumfelds zu treffen. Die tiermedizinische Fakultät der Colorado State University arbeitet daher mit der medizinischen Fakultät zusammen. Beide versuchen im Rahmen des „Rural Track“ Programms, Ärzte und Tierärzte, die abseits der Städte praktizieren, zusammen zu bringen, um so einen Zusammenhalt in Gesundheitsberufen auf dem Land zu fördern.
Selbst auf Warnsignale achten
Dr. Fonken rät aber jedem Tierarzt, das eigene Wohlbefinden selbst im Auge zu behalten und frühe Warnsignale nicht zu ignorieren. Dazu gehören:
- mangelnde Arbeitsmotivation
- Unbehagen oder Gleichgültigkeit im Bezug auf die tierärztliche Tätigkeit
- chronische Erschöpfung
- Unfähigkeit das eigene Engagement aufrecht zu erhalten
- Zynismus und Distanz
- Vergesslichkeit
- Schlafstörungen
- Konzentrationsprobleme
- körperliche Krankheiten
- Gefühl von Hilflosigkeit, Überlastung oder Unfähigkeit Probleme zu lösen
Probleme erkennen und benennen
Wichtig sei es, zunächst die eigenen Probleme zu definieren. Menschen, die vor einen Burnout stehen, wüssten oft nicht, wo sie anfangen sollen. Dr. Fonkens einfach klingender Rat: Listen anlegen, um Wichtiges und Unwichtiges zu trennen. Zu jedem Punkt auf der Liste sollte überlegt werden, wie er umgesetzt werden könnte. Eine Struktur könne Aufgaben, die sich zunächst als unlösbar vor einem auftürmten, den Schrecken nehmen. Gerade die Angst vor dem Unbekannten steigere das eigene Unbehagen. Systematisch zusammengetragene Informationen neutralisierten das Unbekannte durch Wissen. Oft reiche schon das Gefühl, dass man sich gut auf die neue Aufgabe vorbereitet habe, um die Angst vor dem Neuen zu nehmen.
Körperlich fit – seelisch stabil
Körperliches Wohlbefinden ist wichtig für eine seelische Stabilität und umgekehrt. Entsprechend betont Dr. Fonken, dass es wichtig sei, sich gesund zu ernähren, genug zu schlafen, sich regelmäßig zu bewegen und – so banal es klingt – immer ausreichend viel zu trinken. Schon diese Kleinigkeiten würden im Tagesgeschehen zu häufig vernachlässigt.
Erfolge bewusst feiern
Für die eigene Motivation sei es außerdem wichtig, seine Erfolge zu feiern. „Menschen denken in der Regel nur an die Dinge, die nicht gut gelaufen sind und vergessen ihre Erfolge.“ Dr. Fonken rät den Tierärzten, sich jeden Abend drei positive Dinge aufzuschreiben (z.B. erfolgreiche Operationen, Gespräche, etc.) und sich die eigenen Leistungen stets vor Augen zu führen.
wir-sind-tierarzt meint: Aufgabe für Kammern und Verbände
(aw) – Die amerikanische Tierärztevereinigung (AVMA) baut zu dem Thema gerade eine Gruppe bei LinkedIn auf. Dort sollen betroffene direkt Kontakt mit Experten aufnehmen können.
Da die Situation deutscher Tierärzte sich nicht grundlegend von der ihrer amerikanischen Kollegen unterscheidet, wäre es wünschenswert, wenn ähnliche Anstrengungen zur Verbesserung der psychischen Gesundheit von Tierärzten auch von deutschen Berufsverbänden und Fakultäten voran getrieben werden würden.






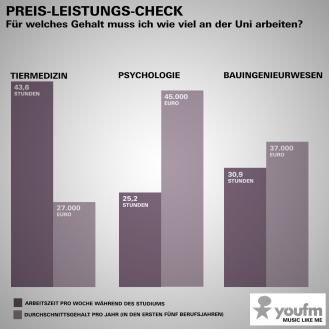

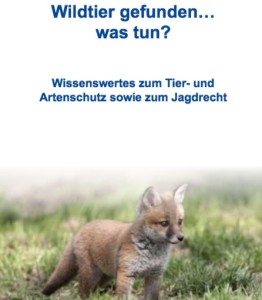 „Wildtiere brauchen in den aller seltensten Fällen menschliche Hilfe," sagt die Landestierschutzbeauftragte Hessen. Was tun kann, wer ein Wildtier findet – oder aber auch besser lassen sollte – erklärt ein Flyer, den Dr. Madeleine Martin zusammen mit der Landestierärztekammer Hessen herausgegeben hat.
„Wildtiere brauchen in den aller seltensten Fällen menschliche Hilfe," sagt die Landestierschutzbeauftragte Hessen. Was tun kann, wer ein Wildtier findet – oder aber auch besser lassen sollte – erklärt ein Flyer, den Dr. Madeleine Martin zusammen mit der Landestierärztekammer Hessen herausgegeben hat.