„Menschen haben eine Würde. Tiere haben einen Wert.“ Dieser „Versachlichung“ der Gesellschaft im Umgang mit Tieren, hielt der Theologe Rainer Hagencord zur Eröffnung des DVG-Kongresses in Berlin entgegen: „Es ist Unsinn einen Graben zwischen Mensch und Tier zu ziehen. Tiere haben ein Bewusstsein.“
von Jörg Held
Wie ihre Halter werden auch Haustiere immer älter und entwickeln immer mehr altersbedingte Krankheiten. Das wissenschaftliche Schwerpunktthema „Geriatrie“ des 62. DVG-Vet-Congress 2016 in Berlin und die damit verbundenen Herausforderungen für Diagnostik, Therapie und Präventivmedizin haben auch eine ethische Dimension: Wann verletzt das medizinisch Mögliche (und vom Halter gewünschte) die Grenzen des Vertretbaren? „Je mehr wir dem Tier eine dem Menschen vergleichbare Würde zusprechen, desto herausfordernder wird unser Umgang mit dem alten Tier,“ sagte Kongress-Präsident Dr. Gereon Viefhues (Ahlen).
„Die Würde des Tieres ist unantastbar“?
Diesem Konflikt von „Wert“ und „Würde“ des Tieres näherte sich als Festredner der Auftaktveranstaltung Dr. Rainer Hagencord. Der katholische Pfarrer leitet das Institut für Theologische Zoologie (Münster). Er fand zur Kongresseröffnung – und im nachfolgenden Workshop – griffige Formulierungen – ohne aber immer eine abschliessende Lösung anzubieten:
Tiere seien eben „keine Reiz-Reaktionsautomaten“, es gebe eine fast schizophrene Unterscheidung zwischen „niedlichen und nützlichen“ Tieren und auch die „strukturelle Sünde der industrielle Nutztierhaltung.“ Ob umgekehrt „Die Würde des Tieres unantastbar ist“ – wie es Titel und These eines Buches formulieren, dass eine „neue christliche Tierethik“ beschreiben will – das stellte Hagencord nur als Frage in den Raum. Ebenso wie: „Kennen Tiere ‚Lebensangst‘, wissen sie wie der Mensch, dass sie auf den Tod zu gehen?“ Oder „sterben Tiere weniger tödlich“ (Karl Rahner)?
Unstrittig ist für den Theologen Hagencord aber immer, dass „Tiere ein Bewusstsein haben. Es ist Unsinn einen Graben zwischen Mensch und Tier zu ziehen.“
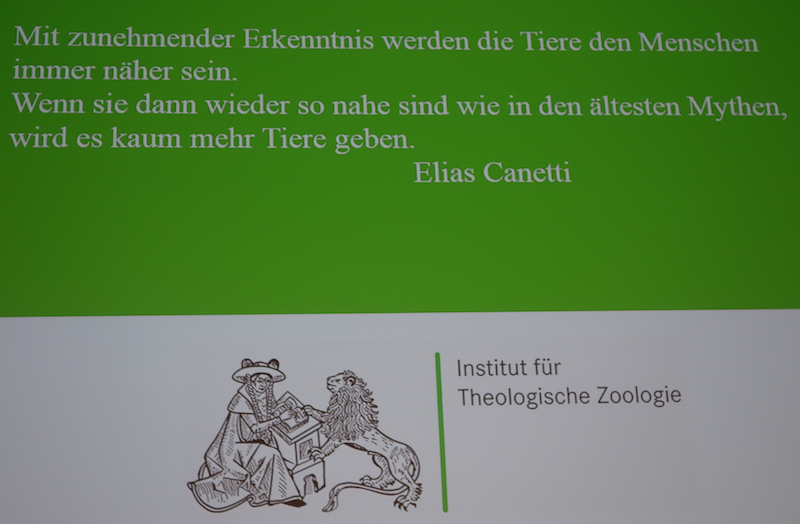
Kommt die Debatte über die Würde der Tiere angesichts eines nahezu ungebremsten Artensterbens zu spät? (Zitat des Literaturnobelpreisträgers Elias Canetti / Vortrag Hagencord)
„Würdelose“ Schlachttiere – „vergötterte“ Haustiere
Doch diese Erkenntnis könnte für viele Tiere zu spät kommen. Für Hagencord geht gerade eine „verheerende Ausrottungswelle über den Planeten“. Im Anthropozän, dem Zeitalter des Menschen, – verschwinden viele Tierarten schlicht von der Erde: In den vergangenen vierzig Jahren hat der World-Wildlife-Fond (WWF) einen Rückgang der Tierbestände um 58 Prozent gemessen. Die über 14.000 untersuchten Tierpopulationen haben sich mehr als halbiert, meldet der gerade vorgestellte WWF-Report 2016.
Für Hagencord verschwinden die Tiere aber nicht nur aus den Ökosystemen in Riff oder Regenwald, sondern „manche schlicht aus unserem Blickfeld und damit aus dem Bewusstsein ganzer Generationen: Pute, Huhn und Schwein leben abgeschottet in modernen Tierfabriken.“ Wir Menschen „denken und handeln gespalten“, wenn es um den Umgang mit Tieren geht: Den einen – den Nutztieren – werde die Würde abgesprochen. „Schlachtkonzerne etwa, bezeichnen Schweine als Rohstoffe – wie kann das sein?“, fragt Hagencord. In die anderen werde sehr viel hineinprojiziert. Haustiere würden vermenschlicht, gar vergöttert. „Die einen verwöhnen wir mit Haustierfutter, die anderen werden dazu verarbeitet.“

Tier haben ein Bewußtsein. Sie sind keine Sache – der Theologe Dr. Rainer Hagencord auf der Eröffnung des DVG-Vet-Congress 2016. (Foto: © WiSiTiA/jh)
„Strukturelle Sünde“ der Fleischindustrie
Hagencord selbst hat zu diesem Konflikt einige klare Positionen – die er im anschließenden Workshop unter anderem so formulierte: „Die industrielle Tierhaltung bringt kein Heil. Sie ist eine strukturelle Sünde.“ Es gebe nur zwei Gewinner: Die Pharma- und die Fleischindustrie.
Andere Stimmen hatten da – womöglich weil es ein Kleintierkongress war – einen schwereren Stand. Auch wenn ein Amtstierarzt oder eine Tierschutzprofessorin darauf hinwiesen, dass es für die Einzeltiere in den Ställen heute deutlich bessere Haltungsbedingungen gebe als vor 30 oder 40 Jahren, bleibt für die etwa 30 Teilnehmer des Workshops mehrheitlich das Ausmaß des industriellen Tierhaltungssystems inakzeptabel.
Die Mensch-Tierbeziehung ist also reich an ethischen Konflikten.
Keine Unterscheidung zwischen „niedlich und nützlich“
Der Theologe will dabei nicht unterschieden wissen zwischen „niedlich und nützlich“. Es sei Zeit, Descartes Definition der Tiere als seelenlose Reiz-Reaktionsautomaten zu überdenken, sie rechtlich nicht als Sache abzuwerten. Schon die biblische Geschichte der Arche Noah sah die Welt vor dem Abgrund. Der Mensch hatte damals wie heute die Aufgabe, sie zu erhalten. Deshalb nahm Noah von jeder Art ein Paar auf, bevorzugte weder Haus- noch Nutztiere noch andere Rassen. „Die Welt des Lebendigen ist so komplex, dass eine Art mehr oder weniger das System zum Einsturz bringen kann. Es dreht sich nicht alles um den Menschen.“
Tiere sind die Dritten im Bunde
So habe schon am Ende der Noah-Geschichte Gott einen Bund mit Mensch und Tier geschlossen: „Sie sind die dritten im Bunde – Tiere haben einen eigenen Wert. Und das bereits in der agrarischen Kultur der Welt Israels. „Die Bibel hat Tiere weder versachlicht noch vermenschlicht – sie waren präsent.“ Biblische Texte ließen sich kaum ohne Tiere denken: „Wenn Sie Tier und Natur daraus streichen, bleibt nicht mehr viel über.“
Theologisch gibt es für Hagencord also viele gute Gründe, Tiere nicht wie eine Sache zu behandeln: „Tiere bringen Segen“.
Weiterführende Links:
Institut für Theologische Zoologie (Münster)
Zwischen Sonntagspredigt und Sonntagsbraten – Gespräch mit dem katholischen Theologen und Ethiker Prof. Kurt Remele, der sein Buch „Die Würde des Tieres ist unantastbar“ als eine „neue christliche Tierethik“ versteht.
Ethik-Kodex der Deutschen Tierärzteschaft und die Empfehlungen zur Umsetzung des Kodex (beide Dokumente als PDF-Download)

Kein Paradies ohne Tiere – Festredner des DVG-Vet-Congress Dr. Rainer Hagencord (Gemälde v. J. Breughel / Foto: © WiSiTiA/jh)

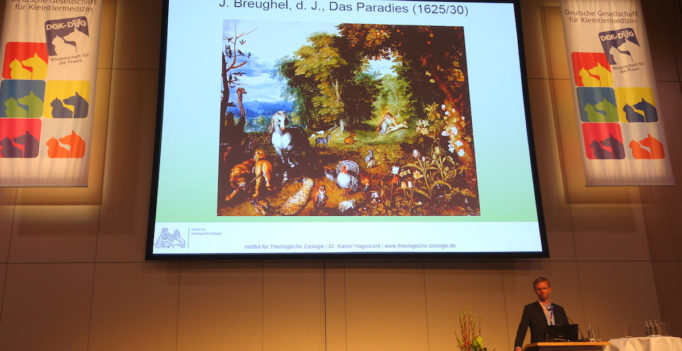






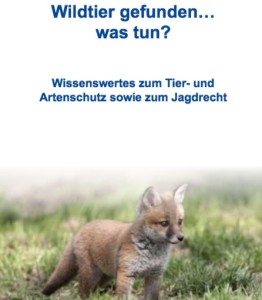 „Wildtiere brauchen in den aller seltensten Fällen menschliche Hilfe," sagt die Landestierschutzbeauftragte Hessen. Was tun kann, wer ein Wildtier findet – oder aber auch besser lassen sollte – erklärt ein Flyer, den Dr. Madeleine Martin zusammen mit der Landestierärztekammer Hessen herausgegeben hat.
„Wildtiere brauchen in den aller seltensten Fällen menschliche Hilfe," sagt die Landestierschutzbeauftragte Hessen. Was tun kann, wer ein Wildtier findet – oder aber auch besser lassen sollte – erklärt ein Flyer, den Dr. Madeleine Martin zusammen mit der Landestierärztekammer Hessen herausgegeben hat.